Theater
Untergang eines egozentrischen Machos — Jean Cocteaus «Orpheus‘ Fall» im
Kellertheater Rheintal
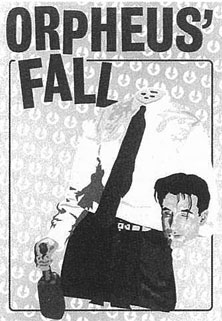
«Vorstellung in der hoffentlich nichts passiert»
|
Theater Untergang eines egozentrischen Machos — Jean Cocteaus «Orpheus‘ Fall» im Kellertheater Rheintal |
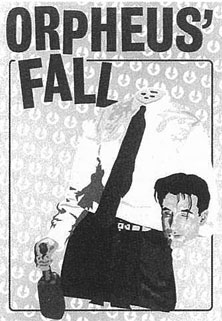 «Vorstellung in der hoffentlich nichts passiert» |
|
Orpheus‘ Fall
Eigenproduktion des Kellertheaters Rheintal nach Jean Cocteau Text und Regie: Wolfgang Schnetzer Bühnenbild: Sand/Wolf Kostüme: Sandra Bra Art Support: Roland Adlassnigg Mit: Michael Heinzel, Paula Rinne, Helmut Ritter, Jasmin Bertschler, Renee Lormanns, Anna Kofler, Bertram Seewald, Bruno Gasser Pförtnerhaus Feldkirch Premiere: 2.4.08, 20 Uhr 4./5./9./LI./12.4.08 jeweils 20 Uhr Karten: Saumarkt, Tel. 05522 72895 office@saumarkt.at |
Kein antiker Mythos wurde wohl so
oft und so vielfältig rezipiert wie die tragische
Liebesgeschichte von „Orpheus und Eurydike“. Von den
Opern von Christoph Willibald Gluck und Claudio Monteverdi über
Jacques Offenbachs komische Operette „Orpheus in der Unterwelt“
und Gedichte von Rilke bis zu den Filmen „Orfeu Negro“
und ‚Vom Suchen und Finden der Liebe“ spannt sich der
Bogen. Michael Heinzel und Wolfgang Schnetzer vom Kellertheater
Rheintal haben auf Jean Cocteaus 1926 entstandenes Theaterstück
„Orphée“ zurückgegriffen und dieses ziemlich
radikal über- und für die Bühne neu bearbeitet.
Allgemein bekannt ist die Geschichte von Orpheus, der aus Liebe zu seiner jung verstorbenen Frau in die Unterwelt hinabsteigt. Durch seinen Gesang bewegt er dort sogar die Götter. Er erreicht, dass ihm Eurydike zurückgegeben wird, verliert sie aber sogleich wieder, da er gegen die Bedingung, sich während des Aufstiegs aus der Unterwelt nicht umdrehen zu dürfen, verstößt. — Zeitlos und universell sind die hier angesprochenen Themen von der Macht der Liebe, der Musik und — letztlich ist alles vergebens — des Todes. Problemlos konnte man diese Geschichte in den Karneval von Rio (,‚Orfeu Negro“) transponieren, den prototypischen Sänger Orpheus in der Tristesse der Weimarer Republik an der Menschheit-Eurydike verzweifeln lassen (Yvan Goll, „Der neue Orpheus“) oder die Trennung durch physischen Tod aufs Erlöschen einer Beziehung durch Entfremdung übertragen (Rilke).
Faszinierende dramaturgische Struktur
Auf Jean Cocteaus Stück stießen Michael
Heinzel und Wolfgang Schnetzer im Laufe intensiver Lektüre. Die
dramaturgische Struktur habe sie fasziniert, nötig sei es aber
gewesen die veraltete Sprache und viele Figuren sowie Situationen an
die heutige Zeit anzupassen. Radikal zurückgenommen hätten
sie auch die vielfältigen mythologischen Anspielungen des
Originals und die christlichen Momente, die Cocteau, der zur
Entstehungszeit des Stückes einer Sekte angehörte,
eingearbeitet hatte. Aus dem Pferdeabrichter des Originals wurde so
ein Würfelspieler, der Wörter aus Buchstaben würfelt,
seinem Spiel immer mehr verfällt und blind für seine Frau
sowie die Bedürfnisse seiner Mitmenschen wird. Mag dieser
|
Egozentriker am Anfang noch ein
gesellschaftlich akzeptierter Schriftsteller sein, so treibt ihn sein
Wahn zunehmend in den Untergang. Da Heinzel/Schnetzer damit statt eines Helden einen Antihelden präsentieren, nennen sie ihre Version konsequenterweise „Orpheus‘ Fall“. Ins Zentrum rücken sie das Beziehungsdrama, das sich durch den Antagonismus zwischen dem Rationalisten Orpheus und der esoterischen Neigungen nachhängenden Eurydike entwickelt, und die Geschichte eines Machos, der alle Feministinnen gegen sich aufbringt.
Tragödie kippt in Komödie
Anders als im Mythos wird sich Orpheus erst, als Eurydike stirbt,
bewusst, wie sehr er seine Frau in Wahrheit liebte. Mit Hilfe des
Engels Gabriel befreit er seine Gattin aus der Umarmung der
Todesgöttin Madame La Mort. Sowie das Paar aber wieder an der
Oberwelt ist, beginnt der Streit von Neuem und endet in der
unvermeidlichen Katastrophe. Nicht lange überlebt dabei der
aufgeklärte Schriftsteller Orpheus den zweiten Tod seiner Frau.
Er fällt gewissermaßen einem Bildersturm zum Opfer, einer
Revolution des Religiösen gegen das Säkuläre und wird,
indem er geköpft wird — den Kopf modellierte Roland
Adlassnigg — zur Büste, die er sich zeitlebens setzen
wollte. Obwohl die Struktur des Stückes eine dramatische ist, ist „Orpheus‘ Fall“ in der Bearbeitung von Wolfgang Schnetzer keine Tragödie mehr, sondern wird aufgrund der Absurdität des Verhaltens der Figuren zur Komödie. Bewusst ist diese Absurdität allerdings nur dem Außenstehenden, weil er in der Lage ist, die sozialen Stereotype zu interpretieren, die die Figuren, weil sie in ihnen gefangen sind, nicht erkennen können. Im Hier und Jetzt angesiedelt thematisiert das Stück grundlegende Konflikte, die zu allen Zeiten mehr oder weniger offen zu Tage treten, wie das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, den Gegensatz von Religion und dem Weltlichen oder zwischen der Freiheit des Individuums und seiner Einschränkung durch den Staat. Walter Gasperi |
Vorankündigung aus Kultur Nr. 3, 2008
Artikel im Original